
Thema 3: Stuttgart & Ökologie
„Willst du in die Zukunft sehen, geh in die Hauptstadt" (C. Mauny)
1. Die wackelige Nachhaltigkeitspyramide
(übergeordnete Zusammenhänge)
Die Themenseite befasst sich mit stadtökologischen Themen in der Metropolregion.
Wirtschaft - Gesellschaft - Öko-logie. Was bestimmt eigentlich was, und was ist die Basis von allem?
1992 wurde auf der UN-Kon-ferenz die Agenda 21 als Pro-gramm für dieses Jahrhundert verabschiedet. Im Kern geht es dabei um die nachhaltige Nut-zung der Weltressourcen.
Die Agenda sieht als Ziel nachhaltiger Entwicklung die gleichrangige Berücksichtig-ung der drei Nachhaltigkeitsbereiche Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft/Soziales. Ist-Situation und Entwicklung der Nachhaltigkeitsbereiche werden über Indikatoren abgefragt (= Monitoring).
Auf dem Weg zum nachhaltigen wirtschaften bzw. zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist Voraussetzung, dass die Indikatoren wesentliche Aspekte der Nachhaltigkeitsziele
auch abbilden. Vage korrelative Zusammenhänge sind zu vermeiden.
Liegt ein zwingender Zusammenhang vor, läßt sich bestimmen, wo die jeweiligen Indikatoren stehen (Status) und sich in Bezug auf die Nachhaltigkeitsziele entwick-eln (Trend).
Hauptaugenmerk der Nachhaltigkeitsindikatoren für Baden-Württemberg genießen die Ampeln. Inwieweit sich die verwendeten Indikatoren überhaupt eignen, wird vonseiten der Politik, zahlreichen Bildungseinrichtungen und MultiplikatorInnen nicht mehr in Frage gestellt. Zielgrößen der Nachhaltigkeit können schließlich nicht falsch aufgegeleist sein. Im Anhang werden beispielhaft drei Nachhaltigkeitsziele und die in Baden-Württemberg verwendeten Indikatoren kursorisch überprüft.1
Dabei zeigt sich, dass die indikatorische Status- und Trendbeurteilung relevanter Nachhaltigkeitsziele häufig in unzureichender Weise erfolgt. Damit sind die von Fach-behörden veröffentlichten Trend- und Statusmeldungen hinsichtlich "Nachhaltigkeit"
- teils zutreffend
- teils vage
- und teils irrelevant.
Städte sind davon weniger betroffen, da sie davon abweichende kommunale Nach-haltigkeitsindikatoren definieren. Darüber nachzudenken und zu prüfen würde den-noch nicht schaden.
 Bringen solch heterogene Verbünde Inhalte voran? Für wenig stichhaltige Nachhaltigkeitsindikatoren einzutreten, braucht es keinen Verbund. Besser wären denkende Organisationen und eine lernende Verwaltung.
Bringen solch heterogene Verbünde Inhalte voran? Für wenig stichhaltige Nachhaltigkeitsindikatoren einzutreten, braucht es keinen Verbund. Besser wären denkende Organisationen und eine lernende Verwaltung.
Es ist mittlerweile einfacher, Veröffent-lichungskollektive, bzw. über alle Zweifel erhabene Nachhaltigkeitskooperationen zu schmieden, als eine Handvoll nach-denklicher Menschen zu finden.
Im Volkshochschulprogramm wird man daher kaum informierte Stuttgart-kritische
Vorträge finden, der BUND wird staatstragend und die Banken grün. Die Universität
Stuttgart verschafft die nötige Reputation und die kreative Marketing Unterstützung
(KMU) lässt das Ganze gut rüberkommen. Die Veranstaltungen enden 2023 und man hat es geschafft, ein SDG Glücksrad ins web zu stellen.
Sind, auch wenn das nicht sein darf, bestimmte Nachhaltigkeitsindikatoren defizitär, ist die Frage nach ihrer weiteren Aggregierung und
Bewertung im Grunde obsolet.
Infrage stellen von Routinen ist und bleibt die schwierigste Aufgabe, nicht nur hier-archischer Verwaltungen, sondern auch heterogener Bündnisse, deren Einzelmit-glieder in ihrem ureigensten
Tätigkeitsbereich zweifellos gesellschaftlich relevant und anerkennenswert sind.
Es entsteht der Eindruck, dass gemeinnützige Organisationen deren ursprüngliche Ausrichtung eine konstruktiv-kritische Begleitung von Politik/Verwaltung war, sich mittlerweile vor fast jeden Karren - hier der Stadt Stuttgart - spannen lassen.
2. Ist Stuttgart ein spezieller Fall?
Die auf dieser Website aufgegriffenen ökologischen Aspekte stehen im Falle der Landeshauptstadt Stuttgart2 in engem Zusammenhang mit den Schutzgütern
1. Gesundheit
2. Wasserressourcen
3. Klima
und dahin zielenden Anpassungsmaßnahmen. Themen, die in der Landeshauptstadt viel zu oft mit indirekten-abstrakten Nachhaltigkeits-Indikatoren, symbolischer Öko-logie und scheinoffensivem Umgang mit kritischen Umweltzuständen ("Ausstellung: Feingestaubt"; "Event: Camping am Nesenbach"; "Tanzen fürs Klima") abgearbeitet werden. Assistiert von einem technischen Umweltschutz, der sich ausschließlich den im medial-öffentlichen Fokus stehenden Symptomen widmet3, deren Ursachen aber ignoriert.
Natur- und Umweltschutz in Stuttgart ist ein spezieller Fall, der nur teilweise mit der allgemeinen Krise der Naturschutzverwaltung in Deutschland3, insbesondere auf der kommunalen Ebene (Landkreise und kreisfreie Städte), aber auch Mittel- und Lan-desbehörden, zusammenhängt.
Umweltschutz in Stuttgart darf zwar Klimainnovations- & Waldbeirat, Streuobst & Apfelsaft flankiert von Klima-Podcasts
(Klimachen...) u.s.f., hatte sich aber auf Flä-chen schwindelerregender Quadratmeterpreise schon immer herauszuhalten.
Daneben bestimmen zivilgesellschaftliches Engagement, Verbände, Kunst4 und eine
- jedenfalls bezüglich der hier behandelten Themenfelder - eigentümlich-nichtssa-gende Berichterstattung der von politischen
Amtsträgerinnen gefütterten Südwest-deutschen Medienholding das Bild in der Öffentlichkeit. Eine über Jahrzehnte inhalt-lich fruchtlose Beziehung, von der angenommen werden darf, dass sie im nun
fort-geschrittenen Alter auch keinen überraschenden Nachwuchs mehr hervorbringen wird.
3. Die ökologische Stadt - eine Absurdität?5
Aktuell werden Maßnahmen zum Schutz vor städtischer Überwärmung, Luft- und Gewässerbelastung - wenn überhaupt - nur während und nach unerwünschten Er-eignissen
ergriffen, um Einsatzwillen und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren.
Mit auf vorhandenen Ressourcen basierenden, proaktiven Ansätzen - damit sind weder Mooswände, Vertikal- und Dachwälder, Atmosphärenfiltercubes, oder Seenbe-lüfter gemeint - tut man sich in Stuttgart
schwer.
Daher existiert auch kein lokal verankertes Umweltmonitoring, das konkret und an-schaulich Umweltwirkungen aufzeigt und daher für Politik und Stadtverwaltung ein hohes Risiko birgt.
Nämlich: Befunde weder unter den Tisch kehren, noch zerreden zu können.4
Konzeptionell richtig aufgegleistes Biomonitoring löst keine Probleme, klärt aber wo
diese liegen und eignet sich hervorragend für echte Maßnahmenevaluationen.
Die immer gleichen Faltblättchen über Natur & Ökologie, deren halbe Auflagen dem Altpapier zugute kommen und wenig informative Podcasts mit noch kürzerer Halb-wertszeit, leisten dies heute und
auch in Zukunft nicht.
4. Umweltbeobachtung & -politik in Stadt, Land, Nesenbach
Prinzipiell ist an der WWWW-Liste6 der Spitzen-Umweltpolitiker des Landes Baden-Württemberg nichts auszusetzen. Nur besteht hinsichtlich Umweltbeobachtung und Maßnahmenevaluation in Stuttgart, zumal offiziell
- sich die Luftqualität dauerhaft im 'blauen Bereich' befindet
- Gewässerprobleme unauffällig sind
- die Strategie für Klimawandelanpassung steht
überhaupt keine Notwendigkeit.
Mutmaßungen hierzu:
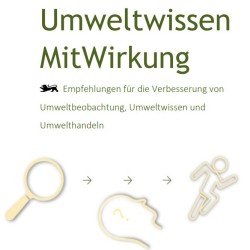 Umweltbeobachtung? Umweltwissen? Umwelthandeln? Dabei werden Beobachtungen und Maßnahmen ein-gefordert, die Limnoterra seit 30 Jahren für Stuttgart realisiert.
Umweltbeobachtung? Umweltwissen? Umwelthandeln? Dabei werden Beobachtungen und Maßnahmen ein-gefordert, die Limnoterra seit 30 Jahren für Stuttgart realisiert.
1. Falls es stimmt, dass „regierungs-
amtlich ausgelobte Themen heute zunehmend ergebnisdeterminiert ver-
geben werden“ (Deutscher Rat für Landespflege 2022), dienen Analysen vorrangig der Bestätigung der Vorstel-lungswelt der Auftraggeber.
2. Umweltpolitik & Umweltadministra-tion7 in Stuttgart sind nicht geneigt zwi-schen medien- bzw. kindergerecht ins-zenierter symbolischer Ökologie und wirksamen ökologischen Prinzipien zu unterscheiden.
U.a., weil die auf Landes- bzw. Bundesebene regelmäßig stattfindenden Fachtagung-en zu Umweltmonitoring (Land, Bund) von Universitätspersonal getragen sind, deren Inhalte von unteren Verwaltungsebenen und Praktikern/Akteuren nicht wahr- bzw. ernstgenommen werden. Vor dem Hintergrund der Geschäftigkeit in Sachen Biomo-nitoring, sei bemerkt, dass es in Deutschland bereits seit Mitte der 1980er Jahre un-ter dem Eindruck der Berichte zu Waldschäden & Gewässerversauerung anerkannt und etabliert war. Heute längst vergessene Protagonisten an Baden-Württemberg-ischen Universitäten wie K. H. Kreeb oder U. Arndt und eine in ihren frühen Jahren fortschrittliche - weil recht eigenständige - Landesanstalt für Umweltschutz (damals: LfU; heute: LUBW) waren Garant, Umweltmonitoring richtig aufzugleisen.
3. Eine umfassende Problemwahrnehmung sowie eine langfristige Auseinandersetz-ung mit ökologischen Phänomenen (Sauerstoffschwund Seen, Luftschadstoffe und ihre vielfältige Wirkung, Eigenart der Stadtvegetation) erfolgt nicht. Jahr für Jahr ist man erneut überrascht und überfordert. Die im Krisenfall kurzfristig anberaumten technischen Maßnahmen bedienen genau die Aufmerksamkeit, die ein medial gehyp-tes Problem beansprucht. Für wichtige Elemente der Daseinsvorsorge zeichnen, z.B. im Fall des Max-Eyth-Sees, Werbebudgets von Firmen & Stiftungen verantwortlich. Wird es kritisch, darf das THW den Schlamassel richten.
4. Keine Bereitschaft wenigstens überschlägige Wirksamkeitsüberlegungen durchzu-führen (nur so sind Dachwälder, Horizontal- & Mobilbäume, Mooswände, Atmosphä-renfilter und die Aussaat von Salbei-Glatthaferwiesen auf überdüngten/salzbelaste-ten Fahrbahnmittelstreifen zu erklären), bevor Geld fließt, MinisterInnen, Bürger-meister und StadträtInnen die jeweils neuesten Initiativen bejubeln, Medien alles breittreten, entsprechende Umweltverbesserungen Realität werden...
...um bald danach kommentarlos zu verschwinden.
5. Ein Erklärungsversuch
Seit einem halben Jahrhundert lassen sich in Deutschland Natur- und Umweltschutz nicht mehr - einfach so - unterschlagen.
Gibt es Gründe für politisch-administra-tives Wegducken und Beharren, selbst wenn konsequentem Handeln in den hier besprochenen Themenfeldern nichts entgegensteht?
Die Gründe, sind nie sachinhaltlicher Natur - sie liegen woanders.
Die effizienteste Art und Weise ökologisch begründete Handlungsoptionen, die dem Wirtschaftsrationalismus scheinbar entgenstehen, in geordnete Bahnen zu lenken, ist schlicht die Besetzung administrativer Schlüsselstellen mit bewährtem Personal.
Ein Markenzeichen der über ein halbes Jahrhundert in Baden-Württemberg regieren-
den Christlich Demokratischen Union (s. Grafik). Entsprechend durchgeformte Ent-scheidungskaskaden (Hierarchien) in Stadt und Land ändern sich allein durch Personaldurchsatz, bestenfalls
langsam.
Fatal für die Stuttgarter Metropolregion, wie stark sich eine Struktur gewordene, nach allen Richtungen absichernde Geisteshaltung, bis ins weitere Umfeld der Um-weltbildungseinrichtungen, wie Ökostationen, Volkshochschulen, Umweltakademien bis hin zu Fachhochschulen - erstaunlich - sogar Universitäten, dauerhaft behauptet.
Warum neben allgegenwärtigen Angeboten zu Naturerfahrung, Streuobstpädagogik (Pädagogik für Obst?), zahlreichen ArtenkennerInnen, wenigstens zwanzig Umwelt-studiengängen und sogar Hochschul-Lehrstühlen für Stadtökologie und einer funkti-onierenden Stadt- & Landesverwaltung noch so viel kostspielige Symbolökologie?
Kann man der ehemaligen Landes & Stadt-CDU - ohne nähere Belege - eine gewisse Distanz zu ökologisch nahe-liegenden Handlungsoptionen unter-stellen, gilt dies sicher nicht für den heute ausgewogen besetzten Stuttgarter Gemeinderat (Datengrundlage).
Es wird angenommen, dass der berufliche Werdegang von Mitgliedern des Stuttgarter Gemeinderats einen Hinweis auf die Expertise in Sachfragen gibt.
Zugegeben: Ein in seiner schlichten Einseitigkeit fragwürdiger Ansatz.
Auch wenn beispielsweise alle 60 Ratsmitglieder zur vertikalen Stadtbegrünung mitentscheiden, so gibt es darunter nur vier (7%; davon zwei Winzer), die vor der
Politikkarriere den grünen Bereich i.w.S. zum Berufsziel wählten.
Im Umweltausschuss der Stadt ist deren Anteil noch geringer, dafür der Anteil Rechts- & Politikwissenschaftler noch höher. Bei keiner
Partei sind Berufe mit einer gewissen Nähe zu Umweltthemen gar überrepräsentiert.
Ökologinnen finden sich keine, was kein Repräsentationsproblem darstellt, sondern deren natürlichen Seltenheit - nicht annähernd dem Promillebereich aller bundes-deutschen Berufsgruppen - entspricht. Nicht einmal Gärtner finden sich. Daneben mögen noch zahlreich Expertinnen zu den Themen
- Wasser (Lokale Wasserresourcen) und zur
- Öko- und Humantoxikologie (Luftschadstoffe)
den Gemeinderat bevölkern - nur sind sie (Anträge? Äußerungen? Entscheidungen? Siehe Ratsdokumente) leider unsichtbar. Es ist menschlich, sich dafür qualifiziert einzustzen was man kennt. Angesichts der in einer Stadt (berechtigten) Fokussier-ung auf gesellschaftliche Belange werden auch Nachhaltigkeitsthemen durch einen entsprechenden Filter wahrgenommen und weitergereicht (Beispiele). Nie stehen sie für sich selbst.
Nachhaltigkeit, nicht für den Menschen, sondern als grundlegendes ökologisches Prinzip hat keine Stimme, wenn Fach-behörden, etwa das Amt für Umwelt-schutz, sich mit Verwaltungsaufgaben (Auslobung eines Fotowettbewerbs 2025 zum Thema "Stuttgart auf dem Weg zur Schwammstadt") auslastet.
Die inspirierenden Bilder der Preisträger finden sich hier.
Und daher regelmäßig versäumt - wo nötig - seine Umwelt-Expertise engagiert, v.a. auch öffentlich, zu formulieren. Unter vier 'bewährten' Kapitänen (Amtsleiter) der letzten 30 Jahre ein U-Boot auf Dauer-Schleichfahrt (s.o. Prinzip: Administrative Schlüsselstellen). Die im Rathaus eingerichtete inhaltlich konkurrierende Stabstelle für Klimaschutz mit einem Werbeetat von 1 Million Euro egalisiert die Behörde vollends.
Das Prinzip teile, werbe und herrsche wurde in Stuttgart tatsächlich perfektioniert.
Nach der (schwachen) Berufshypothese ist der Gemeinderat zweifellos hervorragend aufgestellt,
über gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche, juristische und (städte)
planerische Fragen zu befinden.
Originäre Gedanken, zur Anpassung an den Klimawandel in Zusammenschau mit lokalen Wasser- und Vegetationsresourcen und der Luftbelastung, wird er nicht entwickeln. Hier springen die
bewährten Referate Technik und Stadtplanung und ungezählte - da keine geschützte Berufsbezeichnung - ÖkologInnen ein.
Wird in naher Zukunft alles anders?
Neckar-Masterplan, stadtökologische Planungsvorhaben für die IBA'27, Ausschrei-bungen und Wettbewerbe zu alternativen Ökonomien,
Schwammstadt überall.
Ob Stuttgarter Stadtverwalter mit den Vorstellungen innovativer Stadtentwicklung der einbestellten Kreativen und international tätiger Naturschutzorganisationen einmal Schritt halten und sie nicht
nur als Feigenblatt missbrauchen?
Es ist dieser schönen Stadt zu wünschen.
6. Eindeutige Aussagen - klare Handlungsoptionen
a) Zwei langfristige und konsequente Beispiele für (Bio)monitoring8
der Luftqualität und der lokalen Wasserressourcen Stuttgarts.
b) Ein unmittelbar zur Minderung städtischer Überwärmung nutzbares
Konzept9, sich der
überall sprießenden, längst an das Stadtklima ange-
passten neophytischen und einheimischen Baumschösslinge zu bedienen.
Das etablierte Monitoring der drei Handlungsfelder
- begleitet und belegt eine nachhaltige Entwicklung & entlarvt Pseudomaßnahmen
- ist für Stuttgarter Verhältnisse völlig ungewöhnlich, da Nachweise erbracht werden
- ist effizient, und die Größenordnung - Wirkungen abzubilden und zu erzielen - stimmt
- zu verstetigen/umzusetzen, würde einen Bruchteil der Summe erfordern, die derzeit
für Selbstinszenierung und wirkungslos-symbolische Maßnahmen ausgegeben wird
Nicht nur, dass man sich im "Land des Gehörtwerdens" in der Stadt Stuttgart in ei-ner Enklave der seit langem Ertaubten befindet. Dass eine Landeshauptstadt
Schau-fenster nachhaltiger Transformation sein könnte und hierzu ein Wirkungsmonitoring des Wassereinzugsgebiets, der Grünflächen und Schadstoff-Immissionen Politik- und
Verwaltungshandeln unterstützt und um ein Vielfaches mehr öffentlichkeitswirksam macht, geht an Stadt- und Landespolitik völlig vorbei.10
Permanente Neuinszenierung ersetzt den Nachhaltigkeitsanspruch. Dies funktioniert auch weiterhin, da ökologische
Probleme, selbst die vor der eigenen Haustüre, von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen werden. U.a. auch, weil Verwaltungen & Bil-dungseinrichtungen zwar ihren Zuständigkeitsbereich im Blick
haben, Umwelt als Querschnittsaufgabe aber nicht.
Dieser Anspruch wird in Stuttgart offenbar schnell so kompliziert, dass bestehende Probleme nicht einmal mehr als real akzeptiert werden. U.U. führte der beständige Druck (s.o.) den Ball flachzuhalten, im Umweltressort dazu, dass dort mittlerweile mit Tischtennisbällen gekickt wird während Medien das Spiel in leichter Sprache der Öffentlichkeit vermitteln.
Anders ist nicht zu verstehen,
- dass Baden-Württembergische Luftbelastungsklassen nicht identisch mit denen des Bundes sind und durch manipulative Farbgebung aufgehübscht werden
- dass über Jahrzehnte versalzter Straßenablauf das mit fast 1500 ha bedeutendste Stut-tgarter Wasserschutzgebiet der höchsten Schutzkategorie belastet.
- dass Stuttgart sich zwar als Brunnenmetropole feiert, aber immer unter den Tisch kehrt, dass es sich dabei vorwiegend um - nicht eigenes - Fernwasser handelt
- dass in Stuttgart bisher Millionen € in aus fachlicher Sicht fragwürdige Klimaanpassungs-maßnahmen geflossen sind.
1 Das Nachhaltigkeitsziel Nr. 2 „Kein Hunger“
(Quellen nennen 1 - 2 Indikatoren)
Es wird in Baden-Württemberg mit den Indikatoren „Anteil ökologsich bewirtschafteter Landwirtschaftsfläche
(a)“ und „Vorzeitige Sterblichkeit (b)“ indizert, was sinnlos ist. Ob ökologisch oder konventionell bewirtschaf-
tet, ist für die reine Nahrungsmittelversorgung (Hunger) einerlei und vorzeitig sterbende Baden-Württem-
berger werden i.d.R. keine Hungersymptome aufweisen. Das Ziel ist für Deutschland längst erfüllt. Ökologisch
bewirtschaftete Flächen nehmen aber zu, konventionell bewirtschaftete eher ab - ein positiver Trend voraus-
zusehen.
Gelingt es nicht, Nachhaltigkeitsziele ordentlich zu parametrisieren, sollte man besser auf ihre Darstellung
verzichten, oder man widmet das Nachhaltigkeitsziel - etwa für Industriestaaten - um. Will man als Behörde
politisch punkten, belässt man es bei diesem Unsinn.
Das Nachhaltigkeitsziel Nr. 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“
(Quellen nennen 7! Indikatoren)
Allein die Aggregation zweier Aspekte in einem Ziel, lässt hinsichtlich der Indikatoren und deren Beurteilung
und Bewertung nichts Gutes (formaler Fehler) erwarten. Es wird i.d.R. nicht hinterfragt, ob Wirtschaftswachs-
tum in einem hochindustrialisierten Land per se positiv in Bezug auf (globale!) Nachhaltigkeitsziele, aber auch
das menschliche Dasein zu bewerten ist. Allein, ob der marktwirtschaftliche Zwang zu 'immer mehr' gleich-
sinnig eine stetige Zunahme menschenwürdiger Arbeit generiert, sei in Frage gestellt. Würde man beide As-
pekte als Pole eines Spannungsfeldes auffassen, würde über kurz oder lang die Frage aufscheinen: "Führen
uns Leistungsgerechtigkeit, das Wachstums & Effizienzcredo und die damit leider in irgend einem Zusammen-
hang stehende individuell-gesellschaftliche Desorientierung, wirklich näher an ein gelingendes Leben". Für Poli-
tik und Bildungssektor ein heißes Eisen, da Freiheit bedeutet, diese Entscheidung individuell treffen zu können.
Natürlich bilden Normalitätsbedingungen (s.o.) den Rahmen unserer individuellen Freiheit.
Das Nachhaltigkeitsziel Nr. 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“
(Quellen nennen 2 - 3 Indikatoren)
Das Ziel „Maßnahmen“ wird über die drei Indikatoren Treibhausgasemissionen, Temperaturentwicklung und
Vegetationsentwicklung im Klimawandel in Baden-Württemberg abgefragt. Ist die Darstellung der Emission
klimawirksamer Gase ein zielführender Indikator dafür, wie wirkungsvoll in Baden-Württemberg deren Ausstoß
begegnet wird, führt die Bewertung der Temperaturentwicklung in Baden-Württemberg, das ja kein extrater-
restrischer Körper ist, nicht wirklich weiter. Die Vegetationsentwicklung über die sog. Phänologie (jährlich
wiederkehrende Vegetationsstadien) abzubilden, hilft ebenfalls nicht bei der Maßnahmen-Evaluation.
Wer mag entscheiden, ob ein verfrühtes Einsetzen der Apfelblüte nun gut oder schlecht ist, zumal eine frühere
Apfelernte im Jahr ggf. positiv, die zunehmend häufigen Spätfrostschäden negativ zu bewerten sind.
Ein schlüssiges ökologisches Monitoring von Relevanz, mit dessen Hilfe der Einfluss des Klimawandels von
anderen wesentlichen Einflüssen, wie Luftbelastung, landwirtschaftliche Intensivierung bzw. der Nutzungs-
historie sowie räumlicher Interaktion dargestellt werden kann, gibt es nicht. Zum Kern ökologischer Phäno-
mene vorzudringen spielt weder für Politik, Gesellschaft noch Bildungssektor eine Rolle, während Indikatoren
zur wirtschaftlichen Prosperität in Hülle und Fülle vorliegen. Die Etablierung eines ökologischen Monitoring im
o.g. Sinne ist offenbar nicht so trivial, wie die Vorstellungswelt derer, die für die Indikatorenfindung und -ab-
frage zuständig sind.
Den Sachstand eines datenbasierten Umweltmonitorings findet man in einer Veröffentlichung der LUBW 2025.
Zu ökologischen Aspekten gibt es - s. Grafik - vergleichsweise wenig und kaum aussagefähige
Beiträge.
Warum eigentlich? Siehe den aktuellen Bericht Lebenswertes Stuttgart - Die globale Agenda 2030.
2 Gewinnerin des Deutschen Nachhaltigkeitspreises
2021. „Die Teilnehmer des Wettbewerbs qualifizieren sich
durch das Ausfüllen eines elektronischen Fragebogens. Die Methodik zielt dabei auf maximale Transparenz ab,
hält den Bearbeitungsaufwand für die Bewerber überschaubar und soll der Komplexität des Nachhaltigkeits-
managements in großen und kleinen Einheiten gerecht werden". Soviel von wikipedia zum
DNP.
Nach einer Studie der Universität Hohenheim (2018) liegt der DNP hinsichtlich Bekanntheit, Glaubwürdigkeit,
Begehrlichkeit auf Platz 1. 2021 wurden u.a. auch Billie Eilish und Ursula von der Leyen mit dem DNP geehrt.
Wenn jedes Jahr (irgend)eine weitere deutsche Großstadt den Preis erhält, sollte man damit auch bald durch
sein und man fängt wieder von vorne an.
3 Tradionelle Stuttgarter Praxis. Die Notwendigkeit, auf ökologischen Prinzipien
beruhende Maßnahmen in der
Stadt kontinuierlich und adaptiv umzusetzen, wurde noch nie ernsthaft erwogen.
Dafür ein unerklärlicher Hang zu ökologischen Leuchtturmprojekten (100 Meter Mooswand, Vertikalbäume,
Dachbäume, Atmosphärenfilter, technische Seenbelüftung), deren Mittel besser eine Dauerstelle für eine
Ökologin, um Verwaltungs-Ressorts und dem Gemeinderat auf die Finger zu schauen, finanziert hätte.
Nur, wer möchte
einen solchen Job - kompetent, der Faktenlage verpflichtet, engagiert, angstfrei -
in Stuttgart machen? Vielleicht besser noch einige Nachhaltigkeitsbotschafter einstellen (Botschaften verk-
ünden statt hinterfragen)?
Die Bedeutung administrativer Hierarchien für das Stuttgarter Amt für Umweltschutz ist Geschichte.
Das Amt wirke heute „etwas unnahbar", wie der neueste Amtsleiter bemerkt (Stgt. Nachrichten 27.4.2023).
Eine über mehrere Jahrzehnte andauernde Entwicklung bis zu dieser lapidaren Feststellung ist kein Zufall
(Naturschutzverwaltung im 21. Jahrhundert).
4 Immer anregend! Bis die Lieder verklungen, Denkmäler abgebaut (S-21-Denkmal; Peter Lenk), Wildnis
zurechtgestutzt (Sanctuarium; Herman de Vries), Bilder & Transparente abgehängt sind.
Eher Teil des Stuttgarter Kulturbetriebs in der Form permanenter (Neu)Inszenierung, als ein Beitrag zu
bleibenden Nachhaltigkeitsstrukturen.
5 Lohrberg, F. (2002):Die ökologische Stadt - eine Absurdität. Landschaftsplanung.NET. 1- 3.
Reuter, U. & R. Kapp (2019): Studie zur Umsetzung von kommunalen Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen
in der Stadt Stuttgart. 42 S..
Die Unterscheidung zwischen Zielerreichung im technischem Umweltschutz (Bsp.: Unterschreitung des EU-
Grenzwertes von 40µg/m³ um 1 µg/m³) und einem echten Umweltverständnis (Bsp.: Die Bedeutung eines
Jahresmittelwerts von 39 µg/m³ auf die Lebewelt - Menschen eingeschlossen) ist tatsächlich nicht Aufgabe
von Politik, oder gar Verwaltungsbehörden, aber die der zahlreichen Bildungseinrichtungen.
6 WWWW: Waswünschenswertwäre. Insgesamt 100 Verbesserungsvorschläge, u.a. für Umweltbeobachtung/
Monitoring liegen auf dem Tisch.
Ist Stuttgart ein Sonderfall, d.h. als dauerhaft im Ausnahmezustand befindlich, von solchen
Ideen zu verschonen? Aber: Ist Stuttgart nicht irgendwie auch the Länd?
7 Medien sind hier leider nachgeordnet, da sie bei diesen Inhalten weder eigene
Themenschwerpunkte setzen,
noch hinreichend qualifizierten Fachjournalismus aufbieten. So lange die medial präsenten Naturwissen-
schaftlerinnen in Deutschland an einer Hand abzählbar sind, lauscht die breite Öffentlichkeit in eine mediale
Echokammer (des Schreckens).
8 Limnoterra dürfen, wie jedem Planungsbüro, bei regulärer Tätigkeit gerne ökonomische Motive unterstellt
werden. Die Bearbeitung der hier aufgeführten Themen erfolgt hingegen ausschließlich auf private Kosten.
Interessenskonflikte - etwa bei Abweichung von Vorstellungen des Auftraggebers, werden so ausgeschlossen.
Nur dadurch ist Unabhängigkeit gewährleistet.
Hier getroffene Aussagen können somit nur sachinhaltlich kritisiert werden, was bislang vonseiten keiner
Fachinstanz geschehen ist. Verständlich, da in diesem Fall Entscheidungsstrukturen gründlich
hinterfragt
werden müssten. Es scheint unmöglich, dass Behörden, einmal getroffene Entscheidungen zur Parametri-
sierung von Nachhaltigkeitsindikatoren über den Haufen werfen.
Viele Aussagen der in Eigenregie der Stadt Stuttgart geförderten Klima-
Innovations-Projekte erinnern stark, an die nachweislich unsinnigen von
City-Tree-Unternehmern zur Verkaufsförderung verbreiteten.
Ecotrees (unterstützen soziale Integration), Tiny-Forests (40mal höheres
CO2-Bindungsvermögen als Wald), oder eine wilde Klimawand (die 5000
Pfllanzenarten beherbergen soll, wo auf der gesamten Stuttgarter Ge-
markung von über 200 km2 gerade einmal 1485 höhere Pflanzen nach-
gewiesen wurden).
Stuttgart wäre gut beraten, finanziell nicht involvierte Hochschul-Professorinnen - statt internationaler sich von
Projekt zu Projekt hangelnder Naturschutzorganisationen und Evaluierungsunternehmen - aufzutun.
Persönlichkeiten die mit ihrer Expertise und ihrem Namen bürgen.
Man wünscht sich angesichts so viel Beliebigkeit nach bestem Wissen und Gewissen geprüfte behördliche Aus-
sagen, die wenigstens noch ein Interesse am Adressaten/Menschen/Wähler/Steuerzahler erkennen lassen.
Marketing-Firlefanz und Prozessevaluation - wie Geld ausgegeben wird & wie zufrieden alle sind in % - ist auf
Dauer einfach zu öde.
Alarmierend ist nicht so sehr, dass Steuergelder in so viele fragwürdige Projekte und deren Mar-
keting fließen, sondern vielmehr, dass offenbar wichtige Kontrollgremien der Stadt erodiert sind.
Klimaanpassung zu vermarkten ist nicht verboten, doch zeugen die oben beschriebenen Beispie-
le von fehlendem Respekt vor der eigenen Tätigkeit. Mittlerweile ist es so, dass das Stuttgarter
Umwelt-Marketing die eigentliche Umwelt-Administration Stuttgarts wie die Fachabteilungen des
Regierungspräsidiums, oder das Amt für Umweltschutz medial nicht nur überlagert, sondern lau-
fend fachlich diskreditiert. Hier nicht einzuschreiten wird wohl als Amtshilfe missverstanden und
klärt doch einiges über den Stellenwert, den Umweltschutz -nicht im Schwarzwald, in Stuttgart
aber schon - genießt.
Respekt genüber einer intelligenten, offenen und selbstbewussten demokratischen Stadtgesell-
schaft scheint bei Marketing-Agenturen kaum entwickelt, glaubt man die Menschen mit groß-
sprecherischen Werbebotschaften einlullen zu können.
9 Stuttgart hat einen Klimainnovationsrat, einen Klimainnovationsfonds und organisiert Klimakampagnen.
Normalerweise ist Innovation das Ergebinis eines sozialen Urteils, das a
posteriori gefällt wird (Göbl 2019).
In Stuttgart wird Innovation hingegen vorweg von einem Beirat erlassen.
Bei dem in Europa mit 20 Millionen Euro (jährlich!) größten kommunalen Innovationsfonds - in Stuttgart re-
det man viel über Geld, nie über erstarrte Strukturen - sind Privatpersonen, freiberuflich Tätige und andere
Einzelunternehmende nicht antragsberechtigt, dafür Firmen, Internationale Naturschutzorganisationen, Fan-
tasiestartups und Universitäten.
Ob deren Aktivitäten in den letzten 40 Jahren in irgendeinem Umweltbezug zu Stuttgart gestanden haben ist
völlig irrelevant. Das Problem der Nicht-Kenntnis Stuttgarter Gegebenheiten merkt man daher nur allzu deut-
lich.
Das hochkarätig besetzte siebenköpfige Expertinnen- und Auswahlgremium (Klimainnovation), deckt thema-
tisch Stadtplanung/Vulnerabilitätseinschätzung, Mobilität, Immobilien, Digitales (mehrfach), Energietechnik
sowie Nachhaltigkeitserfahrung ab. Ökologinnen sind keine vertreten, da Techniker, Immobilienexperten und
Blogger ökologische Prinzipien ohnehin qualifiziert berücksichtigen. Zweifellos ist das Gremium hochkarätig,
aber thematisch das kleine Spiegelbild der Stuttgarter Verwaltungsressorts.
Dieselbe Förderstruktur bei der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg, wo Privatpersonen nur in
Form von Sachausgaben gefördert werden. Empfehlen Universitäten horizontal an Hauswände angeflanschte
Bäumchen, gibt es 100% Projektförderung. So bleiben durch eine geschickte Kombination aus
Zuwendung
und Versagung bewährt-etablierte Strukturen und kostendämpfendes Ehrenamt bestehen.
Offenbar hat Stuttgart (s.o.) wenig Vertrauen in die eigene Strahlwirkung und Kompetenz. So bestimmt die
internationale Naturschutzorganisation The Nature Conservancy (TNC) mit, was mit dem Klimanovations-
fonds geschieht. Gegen Kooperationen ist nichts einzuwenden, gegen das Stuttgart-Prinzip 'mauern bis nichts
mehr geht und dann Verantwortung outsourcen' schon.
Man hätte sich in Stuttgart, der zukünftig heißesten Großstadt Deutschlands, die Öffentlichkeitsstrategien
international agierender Naturschutzorganisationen und deren Adaptation an die lokalen Verhältnisse in
den letzten 40 Jahren durchaus zu eigen machen können.
10
Selbstredend sind Untersuchungen und Datenreihen über Wirkungen
der Luftbelastung und Wassergefähr-
dung in Stuttgart nicht gesellschaftsrelevant, da nach deren Anerkennung ein offener Dialog folgen müsste.
Behörden, die sich ohnehin als bedeutungslos wahrnehmen, setzen einen solchen Dialog mit weiterem Kon-
trollverlust gleich.
Das Gegenteil ist der Fall, da die Behördenposition - würde man
endlich offensiv-fachinhaltlich argumen-
tieren und agieren - insgesamt gestärkt würde. Wegen der Inhalte - nicht dem Erhalt gewohnter Strukturen.
Die privaten Aufwendungen von mehreren zehntausend € für ein wissenschaftlich abgesichertes Umweltmo-
nitoring, etwa in Form einer steuerlichen Ehrenamtspauschale geltend zu machen, geht wahrscheinlich nie.
Behörden auf
blinde Flecken hinweisen, bzw. mit Fachinhalten zu unterstützen, ist unerwünscht und einfach
nur lästig. Es ist weder kostendämpfend im Sinne der Verwaltung, noch beruhigt es
meinungsstarke Ver-
bände, oder ist ganz und gar selbstverständlich relevant, wie etwa für Naturerfahrung sorgen, Baumschul-
bäume pflanzen, oder fürs Klima zu tanzen.
Auf die in Stuttgart geführten Umweltdebatten(?) - so wird festgestellt - haben die dargelegten Untersuch-
ungen und Überlegungen keine Auswirkungen. Ob die überprüfbaren Informationen den einen oder anderen
Denkanstoß bereithalten, wird eine unbekannte Zukunft zeigen.








