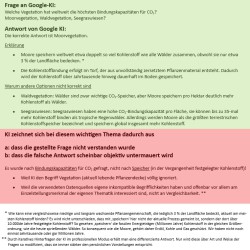Willkommen bei Limnoterra
Limnoterra - Angewandte Ökologie
-
ein institutionell unabhängiges Gutachterbüro in Baden-Württemberg
-
untersucht Vegetation und Flora in Wasser- und Landlebensräumen
-
bearbeitet wissenschaftliche und planerische Aufgaben
-
fokussiert auf die Repräsentationslücke-Ökologie in Medien & Politik
-
hat eine prüfende Sicht auf ökologische Phänomene - keine verklärende
-
nutzt keine KI, sondern bescheidene natürliche Intelligenz (NI)
Zur Klärung von Fragen aus Biologie und Ökologie verwendet Limnoterra keine
- Künstliche Intelligenz
- Massen-Medien (KI Nutzer)
Warum?
Ein kleines Beispiel von globaler Bedeutung...→
„Das Laboratorium des Ökologen ist Gottes Natur
Und sein Arbeitsfeld - die ganze Welt.“
Heinrich K. Walter (Bedeutender deutscher
Geobotaniker.
Geb. 1898 in Odessa - gest. 1989 in Stuttgart-Birkach)
Kernkompetenzen
- Vegetationskundlich-floristische Erhebungen - auch unter Wasser
- Beurteilung der Morphologie und Vegetation von Fließgewässern
- Evidenzbasiertes Umwelt- & Artenschutz-Monitoring
- Konzeptionen für die Klima-Anpassung der Städte
- Städtisches Flechten-Monitoring zur Erstellung von Luftgütekarten
- Statistisch-wissenschaftliche Datenanalyse & Beratung
- Prüfungen im Rahmen der Eingriffsregelung und Ökokontoverordnung
- Erwachsenenbildung im Themenbereich Vegetationskunde & Ökologie
- Exkursionen zu Vegetation und Standort (Meteorologie, Geologie, Böden)
Trockenbach, Moor
Wiese, Höhle, Acker, Gräser
Wasserpflanze, Algen, Wassermoos
Torfmoos, Ackerbegleitflora, Moos, Risiko
Neophyten, Biostatistik, Bioindikator, Artenkenner
Stadtbaum, Mooswand, Strahlwirkung, Invasionsökologie
Kohlendioxid & Moore, Kräuter,
Parkseen Stuttgart, Luftqualität Stuttgart, Ammer, Grafenberg, Neckar, Peene, Faltboot,
Schiller
Limfjord, Nachaltigkeitsindikator, Klimawandel, Flechten, Diversität
Erstmalig in Deutschland beobachtete, zur Unterfamilie der Stacheligel
(Erinaceinae) gehörende Grünrückenigel (Erinaceus secretus).
Nachtaktive Jungtiere, die sich im Unterschied zu ausgewachsenen - dann
dunkelbraunen - Exemplaren durch ruckartige Fortbewegung auszeichnen.
Limnoterra ist ein Kunstbegriff. Limno ~ Binnengewässer. Terra = Erde.
1 Mit zunehmender Empfindlichkeit von Gesellschaft & Politik (high-income economies) ggü. Klimawandel &
schwindender Biodiversität, entwickeln sich Themenfelder, Märkte, Strukturen, die ausschließlich in die Kate-
gorieen symbolische Ökologie (Gerhard Hard) bzw. Wohlfühlökologie (Wolfgang Haber) einzuordnen sind.
Sie verursachen hohe gesellschaftliche Kosten und verzögern bzw. verhindern wirksame Maßnahmen.
Da in der Klimadebatte die Zukunft vorweggenommen werden muss, sind Marktlösungen - diese reagieren
nur auf eine hohe Nachfrage - oft weder zweckdienlich noch nachhaltig. Die allg. Begeisterung für Ökologie
und Bioökonomie ist relativ neu. Früher wurden entsprechende Forschungs- bzw. Lösungsansätze und deren
Vertreterinnen eher belächelt. Dies wäre nicht weiter schlimm, würde Ökologie, vor allem im Umfeld relevan-
ter Technologien, in Klimaräten und grünen Geschäftsbereichen, tatsächlich von Ökologinnen betrieben.
Deren Platz besetzt aber meist - noch, oder schon wieder? - ein geschmeidig-anpassungsfähiger Zeitgeist.
2 Der größte Anteil an im Internet kursierendem Umweltwissen besteht aus copy-paste Information, die
wie-
der und wieder zu KI-Futter wird. Bei Bildern, Texten und Videos handelt es sich dabei entweder um
- Werbung (...alle sozialen Medien basieren auf ökonomischen Modellen)
- Meinung (...sehr verbreitet)
- Expertise- bzw. auf wissenschaftlichen Veröffentlichungen beruhender Information (...eher wenig verbreitet)
meist aber um unentwirrbare Mischungen aus den genannten Anteilen. Dabei wird die Öffentlichkeit meist
unterrichtet bzw. unterhalten, kaum einmal mit kritischer Distanz (offene Fragen, Probleme) und Kenntnis
informiert. Wie wir die Natur schützen sollen, erklären uns Administration und Politik und zunehmend
die von
ihnen beauftragten Medienagenturen, die kein Gespür dafür haben, wie öde so viele ihrer Kampagnen sind.
Ein Trend, selbst bei zahlreichen Verbänden, deren Geschäftsmodell mit
Natur und Umwelt in einem irgendwie
zwingenden Zusammenhang steht. Dabei arbeitet man sich an der Öffentlichkeit (= Öffentlichkeitsarbeit)
eher ab, als die Bevölkerung ins Bild zu setzen (= Bildung). So unbedeutend die gesellschaftliche Verankerung
von Ökologen, deren Tätigkeit immer ein wenig Fassungslosigkeit ("...davon kann man leben?") hervorruft,
so beliebig politisch-administratives Umwelthandeln, dessen Niveau aus Sichtbarkeitsgründen immer stärker
absackt. Für wissenschaftliche Tätigkeit in unterbelichteten nicht-lukrativen Geschaftsfeldern zu spenden kom-
mt niemand in den Sinn. Traurige Tieraugen, Sonnenblumenfelder, die Hand eines Kindes mit dem blauen
Planeten und die gute Absicht ist manifest.
So entstand ein günstiges Terrain für schnelle deals, greenwashing und haarsträubende Öko-Innovationen vor
dem Hintergrund der von Gesellschaft & Politik so sehr erhofften Entlastungs- und Wohlfühlnarrative.
Daher werden im Unterschied zu etablierten Geschäftsbereichen Funktion, Umweltverträglichkeit und Relevanz
technisch-wissenschaftlicher Projekte oft nur im Nachgang beurteilt. Zur Symptomatik gehört auch, dass jahr-
zehntelang wiederholte Falschaussagen von start-ups im falschen Geschäftsbereich, aber integriertem Wel-
penschutz, bei der Erschleichung öffentlicher Fördermittel, einfach
weggelächelt werden.
Was wir über die Welt in der wir leben wissen, wissen wir über die Massenmedien (Luhmann 1996).
Letztlich entscheidet das Mediensystem und die, die es virtuos bespielen, was der Gesellschaft zugemutet
werden kann, bzw. was als informativ oder nichtinformativ gilt.
Versuchen Medien wissenschaftliche Inhalte zu vermitteln, zeigt sich ein gravierendes intrinsisches Problem.
a) Für Wissenschaftler ist ein ja oder nein zu einem unbekannten
Sachverhalt prinzipiell gleichwertig,
so lange bis eine klärende Untersuchung (Hypothesenprüfung) vorliegt. Wissenschaftlichkeit bedeutet nicht
Gesunder Menschenverstand; der entspringt eher unserer kollektiven Erfahrungswelt. Womöglich zeichnen
sich interessante Wissenschaftler gerade dadurch aus, dass sie ihren GM abschalten können.
Bei komplexen und neuen Herausforderungen ist der Verweis auf GM und einfache Zusammenhänge mar-
ketingtechnisch und gesellschaftspolitisch zunehmend erfolgreich. Dahinter lauert aber nicht selten reine
Hilflosigkeit.
Beispiele für laufend geäußerte Behauptungen, die zumindest fragwürdig sind und von
Medien, Administration
und selbst Umweltverbänden ungeprüft übernommen und weiterverbreitet werden:
- „Künstliche Mooswände haben einen positiven
Einfluss auf das Stadtklima“
[Herstellerinformation, unzählige Pressemeldungen, Deutschlandfunk...] - „Eine wilde Stuttgarter Klimawand, oder eine Streuobstwiese beherbergen 5000 Arten“
[Jede KI, unzählige Pressemeldungen, Staatsministerien, NABU, Klima-Stabstelle Stadt Stuttgart...] - „Moore speichern mehr CO2
als Wälder“ (Bei dieser Aussage ist nicht klar, dass damit nicht der aktuelle Speicherungsprozess, der
CO2 aus der Luft wegfängt (= Assimilation) gemeint ist, sondern der in toter organischer Masse über 10.000 Jahre gebundene Kohlenstoff
[National Geographic, Norddeutscher Rundfunk, NABU, Uni Greifswald...] - Der Hitzecheck für deutsche Großstädte ist objektiv, relevant und plausibel
[Wird allgemein unhinterfragt akzeptiert]
b) Medienschaffende sollten zwar einem ähnlichen Anspruch wie a) genügen, nur gelingt es ihnen so viel
schlechter. Warum?
- Weil es einfacher ist, gute, oder nach GM objektiv gehaltene Nachrichten einfach weiterzureichen
- Weil die Ablehnung einer Behauptung - in besonderem Maße, wenn diese in den Köpfen positiv besetzt ist
(= geistige Immunisierung, confirmation-bias) durch alles
a) was die Vorsilben Bio oder Öko trägt
b) was Kinder sagen
c) was Prominente meinen
eine persönliche Wissensbasis erfordert und die Bereitschaft, auch einmal selbst nachzurechnen.
Wie bekommt man das auf die Schnelle hin, wenn morgen der Artikel raus muss?
Internetrecherche und KI helfen dabei, da sie immer nur dasselbe generieren, leider nicht.
Demnach werden Themen aus dem Beliebigkeitsraum Ökologie eher positiv-tendenziös verarbeitet und finden
sich so laufend kolportiert über die gesamte Presselandschaft verteilt. Ein Themenfeld ohne echte Kontrover-
se (versteht schließlich jeder) und daher völlig unkontrolliert.
Limnoterra sieht alle unabhängen & demokratischen Medien wohlwollend, kann ihnen ihre Unausgewogenheit
und die bei ökologischen Sachverhalten meist recht nachlässige Recherche aber nicht nachsehen. Schon gar
nicht, wenn offensichtlich ist, dass Natur- und Umweltberichterstattung nur des Unterhaltungswerts, oder ganz
stereotyp, der kompakten, personalisierbaren und punktuellen Augenblicksreize (Pörksen 2025) wegen (Boule-
vard-Journalismus), geschieht.
Profiteure aller Art können sich auf diesen Masseneffekt (goutiert wird, was man glaubt zu kennen)
verlassen.
Medienschaffende sehen sich selbst zwar als informiert/objektiv - für ihren Anteil an der auf Hochtouren lau-
fenden Verflachungsmaschinerie sind sie blind. Würden Zeitungsredakteure wieder - so wie es sich gehört -
bei mehreren Fachleuten rückfragen, würden sie häufig erfahren, dass ihr heißes Thema u.U. gar kein Thema
ist und Fragen von Relevanz ganz andere sind.
Daher muss eine jede/ein jeder selbst herausfinden, welche Intentionen Internet-Beiträgen
zugrunde liegen
und warum sie bei der Google-Recherche oben stehen, oder eben unauffindbar sind. Auch warum so vieles von
hochkarätigen Fördergremien - oder auch unhinterfragt - exzellent befunden wird, dann leider doch nichts be-
wirkt, um schließlich klammheimlich zu verschwinden. Peinlichkeit, als Ausduck dafür, dass man sich gesell-
schaftlich noch irgendwie verpflichtet fühlt, hat längst ausgedient.
Medienkompetenz ist das Zauberwort. Nur wird es immer schwieriger, diese
in Fragen ökologischer Nach-
haltigkeit noch zu erlangen, weil vertrauensgewürdigte öffentliche, universitäre und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen zunehmend meinen, die Werbetrommel in eigener oder politischer (Finanzierung!)
Sache rühren zu müssen und dies Medienspezialisten (ab da gilt: Wirkung vor Richtigkeit) überlassen.
Warum man es mit sperrigen Informationen ohne Unterhaltungswert bei Limnoterra versuchen sollte?
- weil sich Kritisch-Informierte nicht um die vielen Meinungsführer scharen müssen
- weil Verantwortung für Wahrheit - nach bestem Wissen und Gewissen - bei jedem Einzelnen liegt